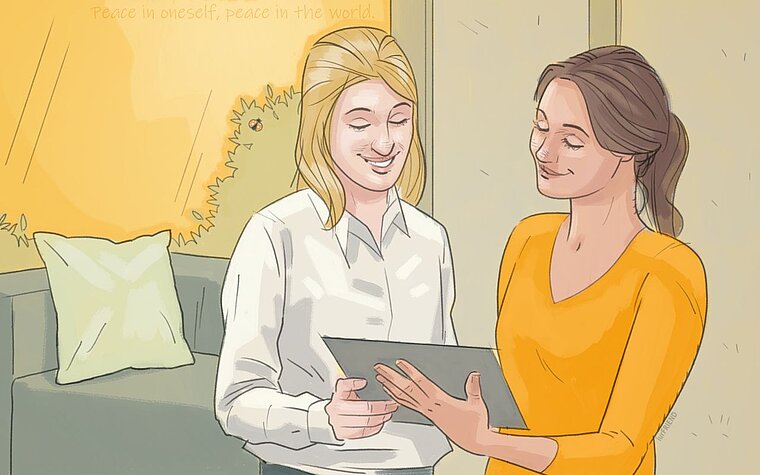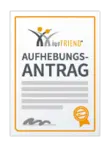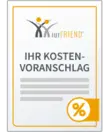Voraussetzungen der Aufhebung
Genau wie bei der Scheidung können Sie die Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft betreiben, wenn Sie wenigstens ein Jahr von Ihrem Lebenspartner getrennt leben. Ist der Lebenspartner mit der Aufhebung einverstanden, ist der erste Schritt zur einvernehmlichen Aufhebung vollzogen. Wenn Sie jetzt noch darauf verzichten, sich über eventuelle Aufhebungsfolgen zu streiten, ist das Ziel schnell erreicht. Es genügt dann, den Aufhebungsantrag beim Gericht einzureichen und auf den Aufhebungstermin zu warten. Sollte Ihr Lebenspartner dem Aufhebungsantrag nicht zustimmen, können Sie auch gegen dessen Willen geschieden werden, wenn Sie drei Jahre getrennt voneinander gelebt haben. Dann endet das Band der Lebenspartnerschaft allein dadurch, dass Sie die Aufhebung beantragt haben.
Was bedeutet eine einvernehmliche Aufhebung?
Einvernehmliche Aufhebung bedeutet, dass Sie sich einvernehmlich trennen und auf jeglichen Streit wegen der Aufhebungsfolgen verzichten. Ihr Vorteil besteht darin, dass Sie in diesem Fall nur einen Rechtsanwalt bzw. eine Rechtsanwältin beauftragen müssen, die für einen der Lebenspartner den Aufhebungsantrag beim Gericht einreicht und ihn im mündlichen Verhandlungstermin vor Gericht vertritt. Der Lebenspartner braucht dem Aufhebungsantrag dann nur zuzustimmen, kann aber selbst keine Anträge wegen eventueller Aufhebungsfolgen stellen. Da Sie sich einvernehmlich scheiden lassen, besteht für irgendwelche Anträge auch kein Bedarf. Es genügt also ein Anwalt. Diesen einen Anwalt brauchen Sie aber auch, da vor dem Familiengericht Anwaltszwang besteht und nur ein Rechtsanwalt den Aufhebungsantrag bei Gericht einreichen und Sie vor Gericht vertreten kann. Wenn Sie nur einen Anwalt beauftragen, sparen Sie die Gebühren für den zweiten Anwalt des Partners. Sofern Sie sich auch nicht über irgendwelche Aufhebungsfolgen streiten, erübrigen sich die Gebühren für Gericht und Anwalt im Hinblick auf diese Folge. Sobald Sie sich jedoch über eine Folge streiten, handelt es sich um eine streitige Aufhebung, für die das Gericht einen eigenständigen Streitwert festsetzt, der die Gebühren für Gericht und zwei Anwälte in die Höhe treibt. Mit der einvernehmlichen Aufhebung fahren Sie also deutlich besser.
Die Aufhebungsfolgenvereinbarung
Sind Sie sich über die Aufhebung als solche einig, kann es sein, dass Sie sich mit Ihrem Lebenspartner dennoch über irgendwelche Aufhebungsfolgen streiten. Die Aufhebung kann dann dennoch einvernehmlich erfolgen, indem Sie die Folgen in einer Aufhebungsvereinbarung (ähnlich der Scheidungsfolgenvereinbarung) regeln. Es bleibt dann bei der einvernehmlichen Aufhebung und deren Vorteilen. In einer Aufhebungsfolgenvereinbarung regeln Sie im gegenseitigen Einvernehmen alle Aspekte, die sich aus Anlass der Aufhebung Ihrer Lebenspartnerschaft ergeben. Sofern ihr Lebenspartner Unterhalt verlangt oder nach Maßgabe einer der gesetzlichen Unterhaltstatbestände berechtigt ist, Unterhalt zu fordern, können Sie die Höhe und Art und Weise des zu zahlenden Unterhalts in der Vereinbarung festlegen.
Achten Sie auf die Form der Aufhebungsfolgenvereinbarung
Aufhebungsfolgenvereinbarungen müssen notariell beurkundet werden. Möglicherweise haben Sie eine solche Vereinbarung bereits aus Anlass der Begründung und Eintragung Ihrer Lebenspartnerschaft getroffen und in diesem Sinne einen Ehevertrag bzw. Lebenspartnerschaftsvertrag vereinbart. Sie können eine solche Vereinbarung aber auch noch aus Anlass der Aufhebung der Lebenspartnerschaft abschließen. Wichtig ist, dass eine solche Vereinbarung notariell beurkundet werden muss. Alternativ können Sie die Vereinbarung auch im mündlichen Verhandlungstermin zu Protokoll des Gerichts erklären. Der Vorteil von notarieller Beurkundung oder gerichtlicher Protokollierung besteht darin, dass eine solchermaßen dokumentierte Vereinbarung zwangsweise vollstreckbar ist. Sollte sich der Lebenspartner weigern, den in der Vereinbarung vereinbarten Unterhalt zu zahlen, können Sie allein auf Grundlage dieser Vereinbarung die Zwangsvollstreckung betreiben. Sie sind also nicht darauf angewiesen, Ihren Unterhaltsanspruch erst mühsam einklagen und dann vollstrecken zu müssen. Sie ersparen sich ein aufwändiges Gerichtsverfahren und damit Prozess- und Anwaltsgebühren. Mündliche Vereinbarungen oder Vereinbarungen, die Sie privatschriftlich zu Papier bringen, erlauben die zwangsweise Vollstreckung hingegen nicht.